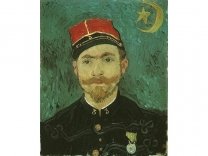
Drama: Woyzeck (1836-1837, genaue Entstehungszeit unbekannt)
Autor/in: Georg BüchnerEpoche: Vormärz / Junges Deutschland
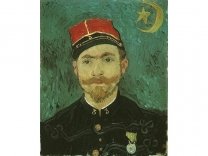
Inhaltsangabe, Analyse und Interpretation
Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um eine Szene aus Georg Büchners 1879 erschienenem Drama „Woyzeck“. Das Drama ist aufgrund des frühen Todes seines Autors Fragment geblieben, weshalb keine feste Reihenfolge der einzelnen Szenen festgelegt werden kann.
In „Woyzeck“ geht es um einen gleichnamigen, in ärmlichen Verhältnissen lebenden Soldaten, der ein uneheliches Kind mit einer Frau namens Marie hat. Woyzeck hat mir ständiger Unterdrückung durch sein Umfeld zu kämpfen und nimmt aus finanzieller Not an einer Erbsendiät teil, was letztendlich dazu führt, dass er im durch die Mangelernährung verursachten Wahn und aus Eifersucht wegen einer Affäre Marie ermordet.
Die zu interpretierende Szene trägt in der Ausgabe des Cornelsen-Verlages den Titel Hc, 7. Gesprächspartner der Szene sind zunächst der Doktor und der Hauptmann, wobei im Verlauf des Dialoges Woyzeck zu ihnen stößt.
Das Thema der Szene ist der Konflikt zwischen den verschiedenen Ständen in der Gesellschaft, welche jeweils durch die einzelnen Gesprächspartner repräsentiert werden. Des Weiteren wird die Unterdrückung durch die Angehörigen der oberen Stände, also des Doktors und des Hauptmanns deutlich, welche Woyzeck gemeinsam bloßstellen und somit ihre Machtposition ausnutzen.
Woyzeck ist aufgrund seines unzureichenden Soldatensoldes auf eine weitere Verdienstmöglichkeit angewiesen, da er seine Freundin Marie und das gemeinsame Kind Christian finanziell unterstützt. Aus diesem Grund erledigt er für den Hauptmann Aufgaben wie etwa das Rasieren. Außerdem nimmt er an einem Erbsendiät-Experiment des Doktors teil, bei dem die Auswirkungen von einseitiger Ernährung auf die Psyche wissenschaftlich untersucht werden sollen und ist wegen des damit verbundenen Energiemangels physisch und psychisch geschwächt. Beide Arbeitgeber nutzen ihn gezielt aus, was auch in dieser Szene der Fall ist. Dazu kommt, dass er den Verdacht hat, dass Marie ihn mit einem wohlhabenden Tambourmajor betrügt, worauf der Hauptmann in dieser Szene Anspielungen macht. Dieser konstante Druck hat schließlich zur Folge, dass er Marie mit einem Messer tötet, nachdem sich die ganze Situation immer weiter zugespitzt hat.
Den Anlass der Szene stellt ein Gespräch zwischen dem Doktor und dem Hauptmann dar, welche sich persönlich bekannt sind und auf der Straße aufeinandertreffen. Woyzeck ist ebenfalls unterwegs und wird von seinem Vorgesetzten durch Fragen ins Gespräch einbezogen.
Die vorliegende Szene lässt sich in zwei Sprechaktsequenzen gliedern. Die erste Sprechaktsequenz geht von Zeile 1 bis 13 und die zweite von Zeile 14 bis 49. Die Grenze zwischen den Textabschnitten bildet das Eintreten von Woyzeck in das Gespräch zwischen dem Doktor und dem Hauptmann, wodurch die Aufmerksamkeit von ihren persönlichen Differenzen auf Woyzeck und die mutmaßliche Affäre von Marie gerichtet wird. Woyzeck bewirkt also einen Themawechsel.
Der erste Abschnitt beginnt zunächst mit einer Begrüßung, die oberflächlich betrachtet höflich erscheint, genauer betrachtet jedoch die Antipathie zwischen Hauptmann und Doktor verrät, weil sich das Gesagte vom Gemeinten unterscheidet. Der Doktor übt zwar respektvolle Gesten wie das Schwingen von Hut und Stock (vgl. Z. 1) und das Hinhalten seines Hutes (vgl. Z. 2) aus, beleidigt den Hauptmann dann aber als „Hohlkopf“ (Z. 3). Daraufhin reagiert dieser mit dem Falten seiner Stirn (vgl. Z. 4) und formt daraus ein Wortspiel mit dem beleidigend gemeinten Wort „Einfalt“ (Z. 4). Durch diese außersprachlichen Handlungen wird die von Konkurrenz und Missgunst geprägte Beziehung der beiden Figuren deutlich, welche beide der Oberschicht angehören. Um seine Unsicherheit gegenüber dem Doktor zu kaschieren, lacht der Hauptmann (vgl. Z. 6) und lenkt das Gespräch auf den vorbeirennenden Woyzeck, der laut ihm „wie ein offnes Rasiermesser“ (Z. 7f.) läuft, was eine Anspielung auf die Szene Hd, 5 darstellt, in der er von Woyzeck rasiert wird. Er beschwert sich außerdem darüber, dass Woyzeck „sich so an [ihm] vorbei [hetzt]“ (Z. 6f.), woran deutlich wird, dass er keinerlei Verständnis für den schweren Alltag des untersten Standes hat, dessen Mitglieder dazu gezwungen sind, von Arbeit zu Arbeit zu hetzen. Der Doktor versucht aus der Bemerkung des Hauptmanns über „lange[n] Bärte“ (Z. 10) einen Nutzen für den weiteren Gesprächsverlauf zu ziehen und bezieht sich auf den römischen Gelehrten „Plinius“ (Z. 12), der angeblich ebenfalls Bärte im Militär ablehnte. Durch diese scheinbar intelligent klingende Fehlinformation versucht der Doktor, sich als Mitglied des gebildeten Bürgertums zu profilieren, welche in der damaligen Zeit des Vormärz ein hohes gesellschaftliches Prestige hatten.
In der zweiten Sprechaktsequenz steht die Druckausübung durch den Doktor und den Hauptmann auf Woyzeck im Mittelpunkt des Geschehens, da er von ihnen systematisch schikaniert wird. Dabei rückt in den Hintergrund, dass sie sich normalerweise nicht leiden können, da sie der „gemeinsame Feind“ Woyzeck verbindet. Der Hauptmann beginnt hier, Anspielungen auf eine mögliche Affäre Maries zu machen. Zuerst geschieht dies indirekt, indem er Woyzeck fragt, ob er „noch nicht ein Haar aus einem Bart in seiner Schüssel gefunden [habe]“ (Z. 14f.). Jedoch hängt er daran durch die Klimax1 „vom Bart eines Sapeur, eines Unteroffizieres, eines – eines Tambourmajors“ (Z. 16f.) einen offensichtlichen Hinweis auf Maries Betrug an. Dadurch wird die Boshaftigkeit des Hauptmanns deutlich. Diese Wirkung wird noch verstärkt, indem er Marie als „brave Frau“ (Z. 17) bezeichnet, was ironisch gemeint ist. Aufgrund seiner fehlenden Bildung vermag Woyzeck zunächst nicht, die sehr eindeutigen Anspielungen des Hauptmanns zu verstehen, und antwortet mit einem militärischen „Ja wohl!“ (Z. 19). Der Hauptmann geht daraufhin noch einen Schritt weiter und beschreibt, dass „wenn [Woyzeck] sich eilt und um die Eck geht, so kann Er vielleicht noch auf [ein] Paar Lippen eins finden“ (Z. 21f.). Durch diese Aussage wird die fehlende Empathie des Hauptmanns klar deutlich. Woyzeck wird „kreideweiß“ (Z. 24) und bezeichnet sich selbst als einen „arm Teufel“ (Z. 25), der „sonst nichts auf der Welt [hat]“ (Z. 25f.). Durch diese Reaktion wird deutlich, dass Marie und sein kleiner Sohn für ihn die höchste Priorität haben, weshalb er es nicht wahrhaben will, dass Marie zu so einer Tat fähig sein könnte. Dies wird dadurch betont, dass Woyzeck die Erde mit dem Adjektiv „höllenheiß“ (Z. 19) beschreibt, welches aus selben Wortfeld stammt und das Wort „unmöglich“ (Z. 30) aus Unglauben und Entrüstung wiederholt. Anstatt etwas zum Gespräch beizutragen oder sogar Woyzeck zu beruhigen, was bei einem verantwortungsvollen Mediziner der Regelfall wäre, nimmt der Doktor eine eher passive Haltung ein und kommentiert allein Woyzecks physischen Zustand, dessen Puls aufgrund seiner Aufregung „klein, hart hüpfend [und] ungleich“ (Z. 28) schlägt und dessen Gesichtsmuskeln als „starr, gespannt [und] zuweilen hüpfend“ (Z. 34) charakterisiert werden. Er hat also kein Interesse an Woyzecks Gesundheit, sondern interessiert sich nur für die biologischen Prozesse, die in seinem Körper ablaufen. Dadurch wird deutlich, dass er Woyzeck nicht als Menschen ansieht, sondern in ihm wohl eher eine Art „Versuchskaninchen“ sieht, dessen alleinige Funktion es ist, seine wissenschaftliche These im Bezug auf die Erbsendiät zu beweisen. Diese Eigenschaft des Doktors taucht ebenfalls in der Szene Hd, 8 auf. Zusammenfassend ist Woyzeck ihm also deutlich unterlegen, da er auf seine finanzielle Unterstützung angewiesen ist.
Woyzecks innerliche Erschütterung wird daran deutlich, dass er ankündigt zu gehen (vgl. Z. 35). Aufgrund seines niedrigen Standes hat er keine Möglichkeit, sich auf angemessene Weise gegen den Doktor und den Hauptmann zu wehren, was auch damit zusammenhängt, dass er sich nicht so eloquent ausdrücken kann wie die beiden und somit bevorzugt, vor ihren verbalen Angriffen zu flüchten. Dies wird durch eine außersprachliche Handlung (vgl. Z. 40f.) verdeutlicht. Er zitiert einen Bibelvers (vgl. Z. 38), woran seine tiefe Religiosität deutlich wird, welche im niedrigsten Stand üblich war und einen Ausweg aus den alltäglichen Problemen bot, die in Gottes Reich nicht existieren. Der Doktor ist stattdessen begeistert von Woyzecks Reaktion, die er als „Phänomen“ (Z. 42) bezeichnet und verspricht ihm sogar eine „Zulage“ (Z. 42), da endlich seine wissenschaftliche These bestätigt wurde und er dadurch vermutlich noch mehr Anerkennung von der Gesellschaft erhalten wird. Gegen Ende der Szene hält der Hauptmann einen Monolog, der widersprüchliche Aussagen enthält und das Motiv des „gute[n] Menschen“ (Z. 46) beinhaltet, welches sich durch das gesamte Drama zieht. Daran wird deutlich, dass der Hauptmann fest von sich selbst überzeugt ist, in Wahrheit aber wenig dahinter steckt.
Die vorliegende Szene hat sowohl eine Funktion für das Verständnis des Dramas als auch für den Leser. Innerhalb des Dramas verdeutlicht die Szene die gezielte Schikane durch den Hauptmann und den Doktor, deren Verhalten von Unmenschlichkeit gekennzeichnet ist. Dieser Faktor trägt neben Maries Affäre mit dem Tambourmajor dazu bei, dass sich der Druck in seiner Psyche zu so einem Maße ansteigt, dass er schließlich sogar die Entscheidung fällt, die Frau, die er über alles liebt, kaltblütig zu ermorden. Ohne die Schikanen und die Unterdrückung durch sein Arbeitsumfeld hätten die psychische Erkrankung und seine untreue Freundin wohl nicht zu so einer Tat geführt. Georg Büchner wollte dem Leser durch die Szene wahrscheinlich zusätzlich die Problematik der Ständegesellschaft vor Augen führen, in der eine bestimmte gesellschaftliche Schicht durch eine andere unterdrückt wird und dabei aufgrund des von Geburt an vorhandenen Klassenunterschiedes keine Möglichkeit dazu hat, sich dieser Form von Sklaverei zu entziehen.
