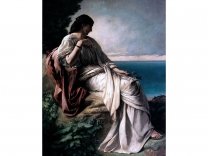
Drama: Iphigenie auf Tauris (1779-1787)
Autor/in: Johann Wolfgang von GoetheEpoche: Weimarer Klassik
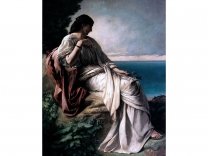
Inhaltsangabe/Zusammenfassung, Szenen-Analyse und Interpretation
Die zu analysierende Szene stammt aus dem Drama „Iphigenie auf Tauris“, welches von Johann Wolfgang von Goethe verfasst wurde. Epochentechnisch lässt sich das Werk der Weimarer Klassik zuordnen.
Der zu analysierende Auftritt führt Iphigenie, die Protagonistin des Dramas, in das Geschehen ein. Sie lebt auf der Insel Tauris, seitdem Sie von der Göttin Diana vor dem Tode gerettet wurde. In dem folgenden Auftritt wird deutlich, dass sie für die Rettung durch die Göttin zwar dankbar ist, sie jedoch von sehr starken Heimweh geprägt ist.
Der Auftritt stellt einen Monolog der Protagonistin dar. Sie betet zu der Göttin Diana, welcher sie als Priesterin auf der Insel dient.
Der Dramenauszug steht zu Anfang des Dramas. Die Protagonistin wird dem Publikum vorgestellt und die Vorgeschichte dargelegt um besseres Verständnis zu schaffen.
Zunächst werde ich den Inhalt des zu analysierenden Ausschnittes kurz zusammenfassen.
Iphigenie beschreibt zunächst, dass sie sich in dem „alten, heiligen, dichtbelaubten Hain[s] (Hain beschreibt hier einen unantastbaren Zufluchtsort)“ noch immer fremd fühlt. Sie sagt, dass sie Heimweh nach dem „Land der Griechen“ habe. Zudem vermisse sie ihre „Eltern und Geschwister“ und sehne sich „[n]ach [ihres] Vaters Hallen“. Zudem beschreibt sie den Zustand der Frauen auf der Insel als „beklagenswert“. Der Mann sei im Krieg oder herrsche Zuhause. Zudem würde sich diese in der Fremde mit anderen Frauen vergnügen. Sie beklagt, dass Thoas, der König der Insel Tauris, sie auf der Insel, wie einen Sklaven, festhalten würde. Sie gesteht der Göttin Diana, dass sie ihr mit „Widerwillen diene“. Sie bittet Diana, sie nach Hause zu bringen und vor dem Tode zu retten. Das Leben auf der Insel beschreibt sie als „zweite® Tod[…]“.
Die Sprache von Iphigenie ist, typisch für ein geschlossenes Drama, sehr gehoben und zudem auch stark hypotaktisch. Der Autor bedient sich diverser rhetorischer Mittel. Er führt zum Beispiel diverse Klimaxe1 an, wie zum Beispiel „[…] alten, heiligen, dichtbelaubten“. Diese Klimax zeigt zudem, wie stark ihre Verehrung für die Göttin Diana und deren Heiligtümer ist. Die Klimax „In ernsten, heiligen, Sklavenbanden […]“ verdeutlicht, wie sehr Iphigenie von dem Leben auf der Insel abgeneigt ist. Zudem bedient sich der Autor einer Vielzahl an Personifikationen2 („manches Jahr bewahrt mich […]“; „[…] bringt die Welle […]“; „Und es gewöhnt sich nicht mein Geist hierher“). Die Personifikation der Welle verdeutlicht die Sehnsucht Iphigenies und lässt den Zuschauer einen präziseren Einblick in die Gefühle der Protagonistin erhaschen.
Abschließend kann gesagt werden, dass der Auftritt den Zuschauer in das Geschehen einführen soll. Es wird deutlich, wie stark Iphigenies Heimweh ist. Sie kann sich nicht auf das Leben auf der Insel gewöhnen, obwohl sie sich schon lange auf der Insel befindet („So manches Jahr bewahrt mich hier verborgen“). Des Weiteren sehnt sie sich nach „dem Land der Griechen“, hier ist vermutlich Griechenland gemeint, ihren „Eltern und Geschwistern“ und nach dem Haus ihres Vaters Agamemnon.
Diese Szene gilt als Exposition des Werkes, „Iphigenie auf Tauris“, von Johann Wolfgang von Goethe. In diesem Monolog beschreibt Iphigenie ihr Wirken und ihren Wirkungsbereich, ihre Vorgeschichte. Des Weiteren beschreibt sie ihren Gegenspieler, den König der Insel, Thoas und beschreibt ihr Heimweh und ihren Wille, nach Griechenland zurückzukehren.
