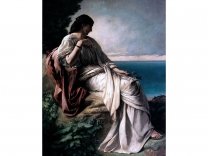
Drama: Iphigenie auf Tauris (1779-1787)
Autor/in: Johann Wolfgang von GoetheEpoche: Weimarer Klassik
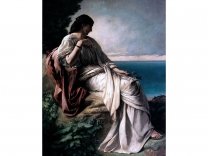
Aufgabe: Interpretieren Sie den angegebenen Ausschnitt (V. 1804- 1919) aus der Szene V. 3.
Inhaltsangabe/Zusammenfassung, Szenen-Analyse und Interpretation
Die Szene V. 3 aus dem Drama „Iphigenie auf Tauris“ (1787) von Johann Wolfgang von Goethe, welches der Epoche der Weimarer Klassik zuzuordnen ist, beinhaltet einen Dialog zwischen Thoas und Iphigenie. Die Szene lässt sich inhaltlich in die fortgeschrittene Handlung bzw. in das Abfallen der Spannung einordnen, weil Iphigenie bereits mit Orest und Pylades ihr Flucht von Tauris plant und so die beiden Handlungsstränge um Orest Schuldtrauma und Iphigenies Heimweh bereits zusammengeführt sind.
Das vorliegende Streitgespräch zwischen der Priesterin und dem taurischen König handelt von der von Thoas angeordneten Opferung der beiden Griechen Orest und Pylades. Als Rache für seinen ausgeschlagenen Heiratsantrag möchte Thoas nun, auf seine Autorität als König gründend, die Opferung durchsetzen, was die Priesterin aufgrund ihrer Humanität ablehnt und ihn hiervon im Dialog argumentativ überzeugen möchte.
Im Mittelpunkt des Auszugs steht die innere Zerrissenheit Iphigenies, die an ihrer Machtlosigkeit gegenüber dem König verzweifelt und mit ihrem Gewissen ringt, ob sie es wagen solle, durch absolute Wahrheit doch noch die Opferung zu verhindern. Sie äußert sich schließlich dem König gegenüber in ebendieser Wahrheit, geht also moralisch in „Vorleistung“ und setzt dadurch die Moralvorstellung der Klassik um.
Der erste Sinnabschnitt (V. 1804-1835) des Auszugs beinhaltet eine Diskussion über die durch Iphigenies Vorwand der Bildnisreinigung geschehene Verzögerung der Opferung. Dieser ganze Abschnitt spielt sich – wie der Rest des Dramas auch – im „Hain vor Dianens Tempel“ ab. Der König kommt also hier zu der Priesterin, woraus bereits die Gleichrangigkeit der beiden ersichtlich wird. So hat Thoas die politische Autorität des Königs, während Iphigenie auf die Göttin Diana verweisen kann. Dieser Bezug auf die Göttin als Autoritätsgrundlage wird bereits durch den Plural des Personalpronomens „uns“ (V. 1804) deutlich.
Nach Thoas Frage, warum sie das Opfer verzögere (vgl. V. 1805), verweist Iphigenie auf den vorangegangenen Dialog mit Arkas (vgl. Szene IV. 2), in dem sie bereits alles erzählt habe (vgl. V. 1806). Nachdem Thoas auf weiteren Details beharrt (vgl. V.1807), verweigert Iphigenie sich, verweist auf die göttliche Autorität und legt ihm nahe, innerhalb einer „Frist“ (V. 1808) selbst nach Gründen für die Verzögerung zu suchen. Der König greift das Substantiv „Frist“ in seiner Replik auf und wirft ihr vor, die Autorität Dianas bloß zum eigenen Vorteil zu nutzen (vgl. V. 1809).
Hierauf setzt Iphigenie zu einem Monolog an, in dem sie durch die Personifikation2 „Herz“ andeutet, dass Thoas das Opfer nur mit eigener innerer Überzeugung befehlen könne. Außerdem wird von ihr die angedachte Opferung der beiden Griechen mit dem pejorativen3 Adjektiv „grausam“ (V. 1810) charakterisiert.
Nun setzt Iphigenie zu einer Kritik daran an, dass Herrscher für „Unmenschliches“ (V. 1812) gegen einen Lohn immer willfährige Vollstrecker fänden und selbst so von der Schuld unberührt blieben (vgl. V. 1812-1820). Dies muss im Epochenkontext der Aufklärung und auch der Klassik als eine Kritik an absolutistischen Staaten interpretiert werden, in denen der Monarch, wie Iphigenie ausführt, geradezu ein „unerreichter Gott“ (V. 1820) war.
Thoas hält Iphigenie für etwas verwirrt und bringt ihre Aussagen durch das Adjektiv „heilig“ (V. 1821) mit ihrem Priesteramt in Verbindung. Dies weist Iphigenie durch einen elliptischen Ausruf (V. 1821) entschieden von sich und definiert sich als die Tochter König Agamemnons (vgl. V. 1822); ebenjener Vater, der sie in Aulis für einen siegreichen Krieg opferte.
Iphigenie proklamiert nun wegen ihrer Abkunft eine königliche Würde für sich selbst, was sie in einer rhetorischen Frage an den taurischen König sogleich pointiert und seinen Befehlsanspruch ihr gegenüber abweist (vgl. V. 1824).
Thoas wiederum bezieht diese Befehlsgewalt nicht auf sich als Individuum, sondern auf das staatliche Gesetz (V. 1831), möglicherweise der aufklärerische Ansatz einer konstitutionellen Monarchie.
Doch Iphigenie kontert, dass man ein Gesetz seinem eigenen Interesse anpassen könne; ein Vorwurf gegenüber ihrem Widerpart (vgl. V. 1832.1833). Iphigenie spricht sich für ein gutes betragen gegenüber Fremden aus, was im klaren Gegensatz zu Thoas steht., wobei sie ihr „Gebot“ (V. 1835) durch das Adjektiv „heilig“ (V. 1836) verstärkt.
Im nächsten Sinnabschnitt (V. 1837-1853) spekuliert Thoas zu Beginn über eine persönliche Verbindung zwischen der Priesterin und den zur Opferung bestimmten griechischen Gefangenen (vgl. V1837f) und warnt sie davor, ihn zu reizen (V. 1839f).
Iphigenie setzt nun wieder zu einem längeren Monolog an, in dem sie ihre Moralvorstellungen durch die Dankbarkeit für ihre Rettung durch die Göttin am Altar von Aulis begründet (vgl. V. 1845-1854).
Sie hofft durch diese Rede Thoas bzw. sein Gewissen, dessen Kälte sie mit der Metapher4 „verschloßnes Herz“ (V. 1844) charakterisiert, zum Verzicht auf die Opferung bewegen zu können.
Im nächsten Sinnabschnitt (V. 1853.1885) rechtfertigt Iphigenie ihre Methode, den König durch Kommunikation von der für sie als moralisch falsch bewerteten Opferung abzuhalten. Thoas wiederum greift die Loyalität Iphigenies zur Göttin Diana auf, die sie selbst im vorangegangenen Abschnitt äußerte. Er wendet dies aber zu seinem Argument, nämlich dass sie genau wegen der Loyalität zu ihrem „Dienst“ die Opferung durchführen müsse (vgl. V. 1855).
Möglicherweise ist Iphigenies Dankbarkeit nicht religiöser, sondern allgemeinmenschlicher Form, was ein Signum für die Säkularisierung und den Klassizismus von Goethes Bearbeitung des Iphigenie-Stoffes wäre.
Iphigenies nächste Rede ist stark emanzipatorisch eingefärbt. Durch einen Ausruf weist sie die Argumentation von Thoas bezüglich ihrer Loyalität zu Diana brüsk von sich (vgl. V. 1856). Sie wirft Thoas vor, ihre körperliche Unterlegenheit auszunutzen (vgl. V. 1856-1857) und proklamiert prägnant ihren Anspruch auf Gleichberechtigung (vgl. V. 1858). Sie sieht ihr mittel der Konfliktlösung in der Kommunikation, im Gespräch (vgl. V. 1863).
Darauffolgend spricht Thoas ihr seine Achtung vor ihren „Worten“ (V. 1863) aus, womit er sicher seine königliche Ritterlichkeit zeigen möchte.
Iphigenie rechtfertigt das Einsetzen der List, also ihre religiös begründete Ausflucht, mit der sie das Stehlen des Götterbildnisses und ihre Flucht von Tauris erreichen wollte, mit der Unterlegenheit des Schwachen (vgl. V. 1866-1872). Sie sieht hierbei die List als verdientes Instrument gegenüber einem „Gewalttätigen“ (V. 1872), was eine sehr negative Charakterisierung von Thoas darstellt.
Es entwickelt sich hierauf eine Stichomythie (V. 1873-1876), in der Thoas seine eigene „Vorsicht der als typisch griechisch wahrgenommenen „List“ gegenüberstellt (V. 1873).
Iphigenie charakterisiert sich als eine „reine Seele“, die „Vorsicht“ nicht brauche (V. 1874). Hier wird sichtbar, das mit einem Erfolg, einem Happy End rechnet, wenn sie ihren Idealen folgt.
Iphigenie schildert ihre Gewissenskonflikte und innere Zerrissenheit durch eine Personifikation der „Seele“, die „kämpft“ (V. 1876).
Bereits in diesem Monolog (vgl. V. 1876-1885) wird deutlich, dass die Idee zur absoluten Wahrheit zwar bereits in ihr vorhanden ist, sie diese aber noch als „bös Geschick“ (V. 1877) abwertet, da sie durchaus mögliche negative Konsequenzen ahnt und scheut.
Der letzte Sinnabschnitt dieses Auftritts (vgl. V. 1886-1919) wird von Thoas eingeleitet, der über eine persönliche Verbindung zwischen der Priesterin und den zur Opferung bestimmten Gefangenen spekuliert. Iphigenie antwortet stocken, was durch Gedankenstriche gezeigt wird, dass sie die gefangenen für griechische Landsleute halte (vgl. V. 1889). Thoas mutmaßt, dass sie deswegen wieder über eine mögliche Heimkehr sinnt, wie sie es schon im ersten Aufzug des Dramas tat (vgl. 1890-1891).
Die Priesterin schweigt einige Zeit (vgl. Regieanweisung), in der sie sicher angespannt nachdenkt und ihre folgende Rede sowie deren Konsequenzen abwägt. Sie beginnt mit einer rhetorischen Frage und spricht sich so selbst die Berechtigung zur „unerhörten Tat“ und der absoluten Wahrheit zu, was wieder im emanzipatorischen Sinne gedeutet werden kann.
Mithilfe weiterer rhetorischer Fragen stellt sie ihren Weg der kommunikativen Vernunft den Heldentaten eines Mannes im Kriege gegenüber (vgl. V. 1893-1908). Außerdem verwirft sie den Weg, es den Männern gleich zu tun und mit Gewalt Konflikte auszutragen, den sie mit dem Vergleich „wie Amazonen“ (V. 1910) beschreibt. Iphigenie wählt den weg der Kommunikation und der Wahrheit und sie weiß, dass dieser auch negative Konsequenzen zeitigen kann (vgl. V. 1914-1915).
Der gräzisierende Ausruf „Allein euch leg ich’s auf die Knie“ (V. 1916) macht Goethes Annäherung an antike Ideale auf künstlerischer Seite deutlich, wie er auch Zeugnis ablegt über Iphigenies Gefühl des Ausgeliefert-Seins gegenüber Thoas. Sie appelliert nun an Thoas Moral, insbesondere an den Wert der „Wahrheit“ (V. 1917).
Der König solle nach Iphigenie die Opferung absagen und dadurch die Wahrheit, die sie im weiteren Verlauf des Dialogs zeigen wird vergelten, bzw. in der Hochsprache der Weimarer Klassik „verherrlichen“ (V. 1918).
Im folgenden Verlauf beichtet die Priesterin dem König das von ihr, Orest und Pylades geschmiedete Komplott, also den Plan zur Flucht inklusive des Raubes des Diana-Bildnisses, wodurch sie gemäß den Werten der Klassik handelt und zum Symbol für diese wird.
Der Dialog verläuft in Form eines gleichberechtigten Streitgesprächs zwischen der Priesterin und dem König. Beide Figuren stehen unter Druck; Iphigenie möchte die Opferung ihrer Gefährten unbedingt verhindern, wohingegen Thoas das Opfer bringen möchte, um dem Volk seine Autorität zu beweisen und so seine Regentschaft zu festigen.
Die Sprechhaltung ist bei Iphigenie davon bestimmt, dass sie große Angst um ihre Freunde hat, aber auch immer wieder Selbstzweifel, ob sie ihren hohen sittlichen Werten und ihrem Anspruch an sich selbst gerecht wird. Thoas‘ Haltung ist von Misstrauen gegenüber der Priesterin gekennzeichnet, die er einst heiraten wollte und die ihm jetzt das Opfer vorenthält. Es zeigt sich im Übrigen die Sprunghaftigkeit von ihm, der einst das Opfer auf Drängen Iphigenies aussetzte und jetzt auf die Exekution des Gesetzes drängt, das er selbst ausgesetzt hatte.
Iphigenie hat einen deutlich höheren Sprechanteil, da sie sich vor Thoas beständig für ihre Haltung rechtfertigt und auch versucht, ihn zu ihren moralischen Werten zu überreden. Außerdem hält sie mehrere längere Monologe, die teilweise auch der Selbstvergewisserung dienen.
In Bezug auf den Aufbau ist eine Steigerung des Gesprächs zu erkennen, die auf den Höhepunkt der absoluten Wahrheit Iphigenies gegenüber dem König hinarbeitet, durch den im Drama eine völlig neue Situation entsteht.
Abschließend soll die hohe Bedeutung der Szene für die Dramenhandlung gezeigt werden. Im Dialog identifiziert sich Iphigenie klar mit der kommunikativen Konfliktlösung, die auf dem Grundwert Humanität beruht. Hiermit wird die im Anschluss folgende Schlüsselszene vorbereitet, in der sie Thoas das Komplott gesteht und so für ihre Moral alles auf das Spiel setzt. In dieser „unerhörten Tat“ zeigt sich der Geist der Aufklärung, nämlich insbesondere der Kategorische Imperativ Kants, der 1787 zwar noch nicht verfasst war, dem Iphigenie aber unübersehbar – in der Szene des Geständnisses – folgt.
In dieser „Utopie“ kann sie so moralisch in Vorleistung gehen, da Thoas „Weimaraner“ (Martin Walser) ist. Sie liefert sich Thoas‘ mutmaßlicher Humanität aus, was es für Iphigenie sogar einfach macht, die Schuld auf ihn zu wenden, weil – im Falle der tatsächlichen Opferung – er es wäre, der den kategorischen Imperativ nicht vollzogen hätte.
