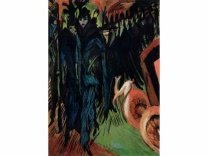Inhaltsangabe, Analyse und Interpretation
Das Gedicht „Augen in der Großstadt“ wurde 1930 von Kurt Tucholsky, der zwischen 1890 und 1935 gelebt hat, geschrieben und thematisiert das einsame Leben in einer Großstadt, welches von vorschnellen Beurteilungen von Menschen bestimmt wird. Bezüglich des Entstehungszeitraum lässt sich das Werk dem Expressionismus zuordnen, thematisch sowie formal hingegen eher der Neuen Sachlichkeit, welche sich inhaltlich mit Themen wie dem Schicksal des „kleinen“ Mannes, der Arbeitslosigkeit und dem Leben in einer Großstadt beschäftigt.
Es besteht aus drei Strophen mit insgesamt 39 Versen, wobei sich immer die vier letzten bis auf die vorletzten Verse einer jeden Strophe wiederholen.
Die erste Strophe besitzt 12 Verse und hat als Reimschema zuerst einen Kreuzreim mit abwechselnd drei und zwei Hebungen und abwechselnd männlich und weiblichen Kadenzen1. Danach schließt sich ein Paarreim mit zweihebigem Jambus und den Kadenzen männlich, männlich, weiblich, weiblich an. Schließlich kommen die letzten vier Verse dieser Strophe mit einem Kreuzreim, welcher auch hier einen Jambus und die Kadenzen männlich, weiblich, männlich und weiblich besitzt. Eine Ausnahme ist, wie in jeder anderen Strophe auch, die rhetorische Frage „Was war das?“ (V. 11, 23, 37), da dieses Stilmittel einen zweihebigen Trochäus darstellt.
Die zweite Strophe hat genau den identischen Aufbau wie Strophe eins, sodass man sehr gut erkennt, dass sie besonders regelmäßig sind, ganz im Gegenteil zu der dritten Strophe.
Die dritte Strophe hingegen besitzt 15 Verse und hat als Reimschema auch zuerst einen Kreuzreim mit abwechselnd drei und zwei Hebungen und abwechselnd männlich und weiblichen Kadenzen. Diesem Versmaß folgend schließt sich ein Parallelismus an mit zweihebigem Jambus und weiblichen Kadenzen. Der anschließende Paarreim hat auch wieder einen zweihebigen Jambus mit weiblichen Kadenzen. Bei dem letzten Kreuzreim, welcher einen Jambus und abwechselnd betont, unbetont, betont und unbetonte Kadenzen besitzt, wurde eine rhetorische Frage, welche auch in den anderen Strophen vorgekommen ist, auf zwei Verse aufgeteilt. Dieser kleine Einschub hat einen zweihebigen Trochäus und eine männliche Kadenz.
In dem Gedicht scheint das lyrische Ich eine Person zu sein, die versucht, die Leserschaft möglichst gezielt anzusprechen um ihm zu zeigen, dass das Gedicht und dessen Botschaft sich auch auf sie direkt bezieht. Dazu nutzt der Dichter Personalpronomen2 wie z. B. „du“ (V. 1) oder Possessivpronomen wie z. B. „dein“ (V. 11). So zieht er eine größere Aufmerksamkeit auf sich und das Gedicht wirkt auf den Leser spannender und interessanter, sodass er sich näher damit befasst.
In der ersten Strophe wird der Alltag von den Menschen in einer Großstadt beschrieben und verdeutlicht. Dieser ist von einer großen Einsamkeit geprägt, obwohl in einer solchen Stadt viele Menschen auf engem Platz leben. Doch trotz dieser Menschenmassen lebt jeder mit seinen Sorgen allein.
Die zweite Strophe handelt über den Lebensweg eines jeden Menschen und beschreibt das Verhältnis zu den Personen, die einem auf dem Weg begegnen, doch welche man genauso schnell vergessen hat. Diese Vergessenheit der Menschen unter sich deutet auf eine oberflächliche Gesellschaft hin.
Strophe drei deutet daraufhin, dass das Leben in einer Großstadt sehr schnell und hektisch ist, da man so in der kurzen Zeit andere Menschen die einem begegnen nicht richtig einschätzen. So vergeht jeder Blickkontakt untereinander bevor man überhaupt weiß, was dieser wirklich bedeutet hat.
Der Dichter benutzt in der ersten Strophe eine Personifikation3 als sprachliches Bild. „Da zeigt die Stadt“ (V. 5) soll verdeutlichen, dass die Stadt sich dem Menschen aufdrängt, sodass der Mensch ihr ausgeliefert und er auf sie angewiesen ist. Mit der rhetorischen Frage „Was war das?“ (V. 11, 23, 37) versucht der Sprecher, den kurzen Blick eines jeden Menschen in einer vollen und von Menschen umgebenen Großstadt zu analysieren, wobei die eigenen Eindrücke in Gedanken umgewandelt werden. Nebenbei ist diese Frage die Kernfrage des Gedichts, da sich diese dreimal wiederholt und sie sich aufgrund des unterschiedlichen Metrums von den anderen Versen stark abgrenzt. Die Metapher5 „Menschentrichter“ (V. 7) wird benutzt, um einen Menschen in einer Großstadt mit einem Gegenstand, wie z. B. einer Flüssigkeit zu vergleichen. Denn ein Trichter wird verwendet, um unterschiedliche und oft wertvolle Flüssigkeiten um zu füllen, sodass von diesen nichts verloren geht und sie eine einheitliche Masse bilden. In Vers acht soll die Hyperbel6 „Millionen Gesichter“ die oft fast unzählbare Anzahl von Gesichtern der Menschen verdeutlichen, die man auf den Straßen sehen kann. So sieht man zwar viele Menschen, kann sie aber nicht individuell einschätzen und beurteilen, da man in einer oft hektischen Großstadt dafür keine Zeit hat. Auch die Anapher7 „Es kann ein Feind sein“ (V. 29ff.) unterstützt diese Einschätzung der Großstadtmenschen untereinander, da man oft die sehr kurzen Eindrücke seiner Mitmenschen nicht richtig wahrnehmen und schließlich deuten kann.
Im Gegensatz zur vollen und oft gefühlslosen Großstadt wirkt die Personifikation „Ein Auge winkt“ (V. 17) wie ein stark betonter Kontrast zur oft mit Menschen überfüllten Stadt. So werden die Gefühle und manchmal auch die Gedanken einer Person oft durch die Augen ausgedrückt. Doch um diese Gefühle oder Gedanken eines jeden richtig zu deuten, braucht man mehr Zeit als ein paar Sekunden oder einen Wimpernschlag. Diese Zeit wird jedoch in einer hektischen und großen Stadt nicht gegeben, sodass man aneinander vorbeischaut. Verstärkt wird dieses sprachliche Bild außerdem von dem Titel des Gedichts „Augen in der Großstadt“.
Für den Lebensweg eines Menschen wird die Metapher „Gang“ (V. 25) benutzt. Sie hebt hervor, dass jeder Mensch in seinem Leben durch eine Stadt gehen muss und seine eigenen Erfahrungen mit der Umwelt und den Mitmenschen sammeln muss. Hierbei benutzt der Sprecher den Imperativ „musst“ (V. 25), um einem klar zu machen, wie notwendig und wichtig dies ist. Doch auch die Wortwahl in Vers 26 „wandern“ ist sehr auffällig, da man das Wort „wandern“ grundsätzlich mit der Natur verbindet. So wird der Kontrast von der Natur zur Stadt sehr deutlich, da der heutige Lebensweg nicht mehr in der Natur, sondern in einer Großstadt stattfindet. Dies hebt auch den Wandel der Zeit hervor, der an beiden dieser Orte unterschiedlich erlebt wird.
Als abschließendes Analysefazit des Gedichts „Augen in der Großstadt“ von Kurt Tucholsky lässt sich sagen, dass er den Leserinnen und Lesern deutlich vor Augen zeigt, wie wichtig es ist, sich in einer vollen und hektischen Großstadt Zeit für die anderen Menschen zu nehmen. Man muss sich mit ihnen näher befassen um zu merken und zu erkennen, was ein Blickkontakt oder ein anderer Mensch für einen selbst bedeutet, sodass man sich eine Beziehung aufbauen kann und man nicht in einer mit Menschen überfüllten Stadt alleine leben muss.