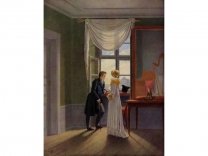Inhaltsangabe, Analyse und Interpretation
Liebe ist etwas Allgegenwärtiges. Sie kann sehr schön sein, aber auch Menschen verändern. Manchmal sogar ohne, dass sie es wollen oder merken.
Davor kann sich auch das lyrische Ich in dem Gedicht „Neue Liebe, neues Leben“ von Johann Wolfgang Goethe aus dem Jahre 1775 nicht schützen.
Das Gedicht handelt davon, dass das lyrische Ich bemerkt, dass es sich verändert hat. Daraufhin versucht es den Grund zu finden. Er merkt, dass es seine Geliebte ist und versucht ihr zu entkommen.
Goethe appelliert an den Leser, bei der Partnerwahl darauf zu achten, ob sich die Liebe zum Verhängnis entwickeln könnte.
Die erste Hälfte jeder Strophe ist im Kreuzreim und die zweite Hälfte im Paarreim verfasst. Dies steht für die Verwirrung und Unsicherheit (Kreuz), die eine Beziehung (Paar) auslösen kann. Das Metrum1 ist durchgängig ein Trochäus, welcher für das Schlagen des am Anfang erwähnten Herzens steht. In der Hälfte der Strophe, die im Kreuzreim verfasst ist, wechseln sich die Kadenzen2 in jedem Vers ab. In der anderen Hälfte jeder Strophe, die im Paarreim steht, sind die Kadenzen Parallel zu den Reimen. Beides steht für den Idealfall, eine ausgeglichene Beziehung.
Das Gedicht beginnt damit, dass das lyrische Ich sein „Herz“ (V. 1) fragt, „was […] das geben [soll]“ (V. 1). Das Herz ist ein Symbol für Liebe und der Parallelismus verstärkt dies nochmal. Es folgt eine rhetorische Frage, „[w]as [sein Herz] bedränged […]“ (V. 2). Es scheint also etwas nicht zu stimmen. Daraufhin erfährt der Leser, dass „ein […] neues Leben“ (V. 3) der Grund dafür ist, dass sich das lyrische Ich „nicht mehr [erkennt]“ (V. 4). Auch die Inversion3 „Weg ist alles“ (V. 5) bestätigt, dass das lyrische ich von der Beziehung und seinen Gefühlen verwirrt ist. Die Anapher4 „Weg“ (V. 5,6,7) zeigt in drei Versen auf, inwiefern sich das lyrische Ich verändert hat. Er erkennt zum Beispiel, dass er Dinge, die er früher mochte, jetzt nichtmehr mag. Die Strophe endet mit der Interjektion5 „Ach“ (V. 8), welche die Verzweiflung des lyrischen Ichs darstellt. Außerdem fragt es sich selbst, wie es in diese Situation gekommen ist (V. gl. V8).
Des Weiteren fühlt sich das lyrische Ich „[ge]fesselt“ (V. 9) von der „Jugendblüte“ (V. 9), die für ein junges (Jugend), gutaussehendes (Blüte) Mädchen steht. In den nächsten beiden Versen wird sie mit einer Anapher weiter beschrieben. „Diese […] Gestalt, Dieser Blick […]“ (V. 10-11). Der Schein scheint jedoch zu trügen, da sich das lyrische Ich „[m]it unendlicher Gewalt […] ihr entziehen“ (V. 12-13) will. Die Inversion unterstreicht die Dringlichkeit dieses Fluchtversuches, wie auch das Wort „rasch“ (V. 13). Mit dem Parallelismus „mich“ (V. 13,14,15) sucht er drei Verse lang den Mut, sie zu verlassen, jedoch „[f]ühr[t] […] [s]ein Weg zu ihr zurück“ (V. 15,16). Seine Verzweiflung darüber drückt er erneut mit der Interjektion „Ach“ (V. 16) aus.
Das lyrische Ich wird mit einem „Zauberfädchen, [d]as sich nicht zerreißen lässt“ (V. 17,18) festgehalten. Es ist ein Symbol für die Magie der Liebe, aber auch für die Bindung, die dem lyrischen Ich zum Verhängnis wird. Außerdem ist es ein Diminutiv6, welches den Bund verharmlosen soll, obwohl das lyrische Ich daran scheitert. Mit den Worten „wider Willen“ (V. 20) wird erneut deutlich, dass das lyrische Ich ein Problem mit dem „liebe lose[n] Mädchen“ (V. 19) hat. Er „[m]uss in Ihrem Zauberkreise [l]eben“ (V. 21-22). Der Zauberkreis ist ein Symbol für die Liebe, mit der er nicht zurechtkommt. Zum Ende hin wird nochmal klar, dass das lyrische Ich mit den Veränderungen, die durch die Liebe entstehen, nicht leben kann und lieber alleine wäre (vgl. V. 23-24). Auch die Wiederholung „Liebe! Liebe!“ (V. 24) und die darin enthaltenden Ausrufezeichen verdeutlichen seine Verzweiflung.
Zusammenfassend kann man sagen, dass es wichtig ist, sich in einer Beziehung die Freiheit offen zu lassen, seinen Partner verlassen zu können und man selbst immer einen klaren Kopf bewahren sollte, dass man merkt, wann man die Beziehung beenden sollte und wie. Am besten sollte man schon bei der Partnerwahl darauf achten, dass die Person einen nicht zu stark verändert und man nicht wie das lyrische Ich endet.