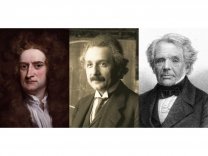
Drama: Die Physiker (1961)
Autor/in: Friedrich DürrenmattEpoche: Gegenwartsliteratur / Literatur der Postmoderne
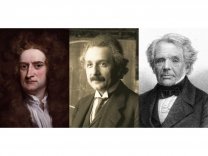
Die Seitenangaben der nachfolgenden Szenenanalyse beziehen sich auf dieses Buch:
Die Physiker. Eine Komödie in zwei Akten
Diogenes Verlag
ISBN 978-3257230475
Inhaltsangabe/Zusammenfassung, Szenen-Analyse und Interpretation
Die Tragikomödie „Die Physiker” wurde 1961 von Friedrich Dürrenmatt verfasst und thematisiert das Problem der Verantwortung des modernen Naturwissenschaftlers der Menschheit gegenüber. Konkreter Hintergrund ist die Zeit des Kalten Krieges, in der mehrfach die atomare Auseinandersetzung zwischen den Supermächten drohte. Der Abwurf der ersten Atombombe über Hiroshima am Ende des Zweiten Weltkriegs hatte deutlich gemacht, wie schnell wissenschaftlicher Triumph in die Gefährdung der Menschheit umschlagen konnte. Dürrenmatts Stück spielt in dem privaten Sanatorium „Les Cerisiers“, welches von Mathilde von Zahnd, einer berühmten Ärztin für Psychiatrie geleitet wird. Es geht um den Aufenthalt dreier Kernphysiker, Einstein, Newton und Möbius, welche alle ihre Pflegerinnen ermordet haben, um so ihre Geheimnisse zu wahren. Schließlich stellt sich später heraus, dass keiner von ihnen wirklich geisteskrank ist, sondern sie alle mit unterschiedlichen Absichten freiwillig in die Irrenanstalt gekommen sind.
Der vorliegende Dramenauszug des zweiten Aktes ist von zentraler Bedeutung in Dürrenmatts Stück. Nachdem Möbius seine beiden Kollegen Einstein und Newton überzeugen konnte in der Anstalt zu bleiben und so die Welt vor dem Missbrauch der Erfindungen und möglicher schlimmer Folgen zu schützen, ruft Mathilde von Zahnd nun alle drei zu sich und teilt ihnen ihr schreckliches Geheimnis mit. Sie habe sich bereits Möbius’ Wissen angeeignet und möchte nun die Weltherrschaft erringen. Dabei enthüllt sie sich als die eigentlich Verrückte und die Szene stellt so die dritte und folgenreichste Enthüllung in dem Stück dar. Hier kommt es schließlich zur Katastrophe, während es in der früheren Szene noch so schien, als nähme das Stück ein glückliches Ende.
Zuerst bemerkt der Zuschauer eine deutliche Veränderung in der Bühnenatmosphäre. Die Pfleger tragen nun beide „eine schwarze Uniform1 mit Mütze und Pistolen“ (S. 78). So wird eine bedrohliche und fast gefährliche Stimmung erzeugt. Diese Änderung von einer zuvor feierlichen und nun zu einer beängstigten Stimmung wird auch durch den Wechsel des Porträts an der Wand symbolisiert. Dieses wird nun durch eines von Zahnds Großvater, einem General ersetzt (S. 78). So werden düster-militärische Assoziationen beim Zuschauer hervorgerufen. Ebenfalls verwirrend für den Zuschauer, der noch nicht weiß, was folgen wird, ist die Aussage: „Er liebte Heldentode, und so was hat in diesem Hause ja nun stattgefunden“ (S. 78), eine Vorausdeutung auf das Ende des Stücks.
Die drei Physiker jedoch scheinen noch nichts von der schrecklichen Wendung zu ahnen. Sie bedienen sich der lyrischen Sprache und sprechen von einer „andächtigen Nacht“ (S. 79) oder von dem Funkeln des „Jupiter und Saturn“ (S. 79). Es scheint, als hätten sie ihre innere Ruhe gefunden, und wären zufrieden mit ihrer Entscheidung in der Anstalt zu bleiben. Mathilde von Zahnd jedoch redet nun amtlich streng und spricht Newton und Einstein mit ihren richtigen Namen an (S. 80). Das verwundert nicht nur die beiden Physiker, sondern auch dem Zuschauer wird ihr zwiespältiger Charakter klar. Die Gesprächsanteile der Ärztin überwiegen, so wird ihr herrisches Auftreten deutlich unterstrichen, während die drei Physiker meist schweigen und sichtlich perplex sind. Newtons Lachen (S. 80) macht deutlich, dass er noch gar nicht richtig begreifen kann, was gerade passiert und sehr nervös ist. Schließlich wir die Atmosphäre noch bedrohlicher, als ein Pfleger „innen das Licht ausgelöscht“ (S. 81) hat. Die Villa sei nun von Wärtern umstellt und jeder Fluchtversuch sinnlos (S. 81). Die Ausweglosigkeit der Situation ist so endgültig klar. Als Mathilde von Zahnd schließlich mitteilt, auch ihr sei „der goldene König Salomo erschienen“ (S. 81), wird den Physikern klar, dass sie verrückt ist. Jetzt weiß der Zuschauer, wieso, als Möbius nach seinem Mord auf den Befehl des Salomos verweist, das Eindruck auf Mathilde von Zahnd macht. Vergeblich versuchen sie ihr das bewusst zu machen, doch die Ärztin redet einfach weiter. Sie ist deutlich die dominante Person im Gespräch. So wird dem Zuschauer ihre Willkür und die Menschenverachtung bewusst gemacht. Jahrelang habe sie Möbius immer wieder betäubt und seine Aufzeichnung fotokopiert, bis sie „auch die letzten Seiten besaß“ (S. 82). Trotz ihrer Verrücktheit, aber mittels ihrem raffinerten Charakter schaffte sie es ihren Plan zu verwirklichen. Möbius will sie dazu bewegen das Vernünftige zu tun, doch wird von der Ärztin darauf hingewiesen, dass er und seine beiden Kollegen in der Öffentlichkeit „machtlos“ (S. 83) sind. Wegen ihrer Morde werden sie in der Öffentlichkeit nur als verrückte Mörder angesehen. Die Physiker und der Zuschauer erfahren so, dass Mathilde von Zahnd die Morde eingeplant hatte und ihr karitatives und besorgtes Verhalten nur eine Illusion war. Ihre Machtstellung hebt sie durch den Vergleich besonders hervor: „Ihr wart bestimmbar wie Automaten und habt getötet wie Henker“ (S. 84). Den Physikern wird schließlich die Sinnlosigkeit ihres verantwortungsvollen Handelns bewusst.
Sie seien in ihr eigenes Gefängnis geflüchtet (vgl. S. 84).
Durch dieses Paradoxon verdeutlicht Dürrenmatt die Absurdität der heutigen Welt.
Alle drei sind geschockt von der Wahrheit und schweigen so die meiste Zeit. Die Ärztin aber gibt ihren machtgierigen Charakter preis und enthüllt sich als Psychopathin voller Minderwertigkeitskomplexe. Ihre anfängliche Sympathie hat rasch in Grauen und Entsetzen umgeschlagen. Ihre Abnormität wird durch ihre Selbstbeschreibung als bucklige „Jungfrau“ (S. 85) erneut bekräftigt. Schließlich verlässt sie den Raum, ihr Weltunternehmen starte nun und die Produktion rolle an (S. 85). Damit repräsentiert die Ärztin Mathilde von Zahnd im übertragenen Sinn sichtlich die wirtschaftlichen, industriellen und militärischen Kräfte, welche die Erfindungen zugunsten ihres politischen Systems missbrauchen.
Dürrenmatt verdeutlicht mit der Szene also viele Kritikpunkte der heutigen Gesellschaft. Er sieht die Gefährdung der Menschheit durch die mögliche Machtübernahme von bindungs- und verantwortungslosen Politikern, den Verlust der Freiheit des Individuums, das Versagen der Justiz in der paradoxen2 Welt, sowie die Sinnlosigkeit des mutigen Handelns des Einzelnen. Die drei Physiker sind, genauso wie die Zuschauer selbst, entsetzt. Möbius stellt resigniert fest: „ Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden“ (S. 85). Ihnen bleibt nichts mehr, als aufzugeben und sich schließlich dem Publikum vorzustellen. Sie verdeutlichen damit ihr Scheitern im Kampf gegen die Machtübernahme von selbstsüchtigen Politkern.
Demnach hat diese Schlussszene Wendepunktcharakter und das zentrale Thema des Dramas wird noch einmal entscheidend bekräftigt. Dem Zuschauer wird das Paradoxe der heutigen Welt vor Augen geführt und er erkennt, dass das verantwortungsvolle Verhalten des Einzelnen in der heutigen Gesellschaft sinnlos ist und ein Problem, was alle betrifft, auch nur gemeinsam gelöst werden kann.
